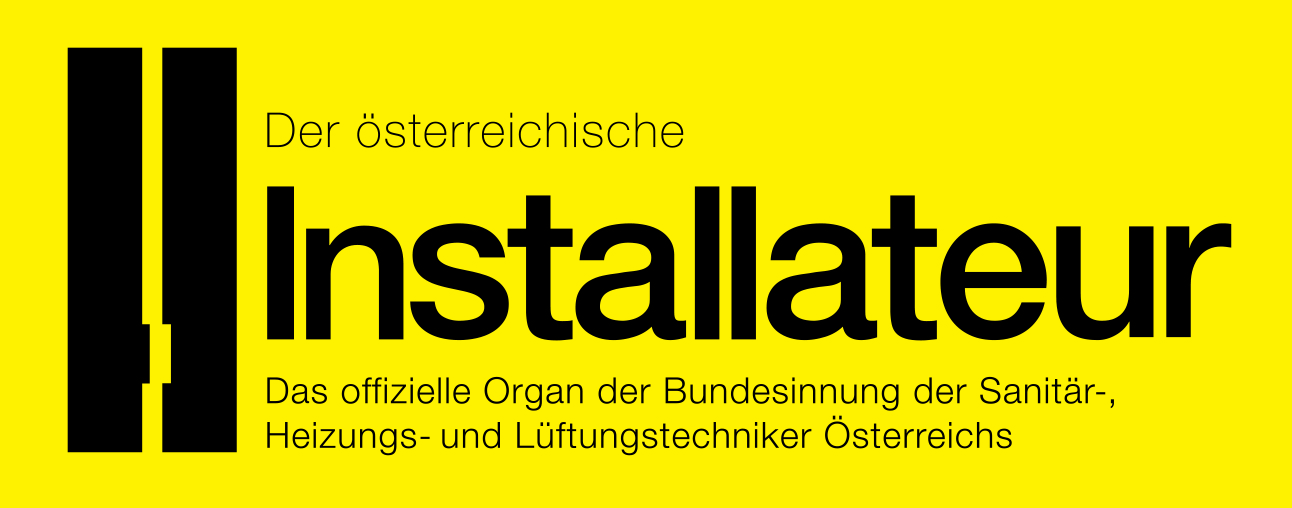Wärmepumpen können auch im sanierten Altbau sinnvoll sein.
Quelle: Zukunft Altbau
Fast die Hälfte der neu errichteten Wohngebäude werden von Wärmepumpen beheizt. Im Bestand wächst der Trend zu den umweltfreundlichen Heizungssystemen ebenfalls. Dass die Wärmeerzeuger auch dort gut funktionieren und klimafreundlich sind, zeigen neue Ergebnisse aus der Forschung. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sollten deshalb bei einem Heizungstausch prüfen lassen, ob die Technologie auch bei ihnen sinnvoll einsetzbar ist. Bedacht werden muss jedoch, dass äußere Faktoren für einen erfolgreichen Betrieb ebenfalls wichtig sind, sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau. Das Haus sollte gut gedämmt sein und einen möglichst geringen Energiebedarf haben.
Wärmepumpen heizen die Wohnung und erwärmen zudem das Wasser für Küche und Bad. Rund 50 Prozent aller Neubauten werden inzwischen mit der Technologie ausgestattet. Beim Heizungstausch im Gebäudebestand ist der Anteil geringer. Auch hier ist jedoch ein Trend zur Wärmepumpe zu beobachten. Ein Blick auf die Förderanträge zeigt, dass sich allein 2020 beispielsweise 30.000 Hauseigentümer für eine Wärmepumpe als Ersatz für eine alte Ölheizung entschieden haben.
Doch noch scheuen einige Hauseigentümer den Einbau einer Wärmepumpe in bestehende Wohnhäuser. Weit verbreitet ist die Meinung, dass die Wärmeerzeuger im Bestand nicht genug und zuverlässig Wärme liefern sowie zu wenig Kohlendioxid einsparen können. Diese Bedenken räumt ein Feldtest des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE nun gründlich aus. Die Ergebnisse der im Sommer 2020 veröffentlichten Studie: Die untersuchten Wärmepumpen lieferten die gewünschte Wärme und waren kaum von Betriebsstörungen betroffen. Die errechneten Kohlendioxid-Emissionen der Außenluft-Wärmepumpen lagen 19 bis 47 Prozent unter denen von Gas-Brennwertheizungen. Bei den Erdreich-Wärmepumpen waren die entsprechenden Werte sogar 39 bis 57 Prozent niedriger.
Erfolgreicher Betrieb hängt auch von äußeren Faktoren ab
Hauseigentümer müssen jedoch bedenken, dass äußere Faktoren für einen erfolgreichen Betrieb von Wärmepumpen wichtig sind. Dazu zählt vor allem der energetische Zustand des Hauses. Nur mit einer ausreichenden Dämmung der Außenbauteile sinken die Wärmeverluste des Gebäudes und damit das erforderliche Temperaturniveau der Heizung. Für Wärmepumpen ist das entscheidend, denn sie arbeiten bei niedrigen Vorlauftemperaturen wesentlich effizienter. Die Vorlauftemperatur sollten möglichst nicht über 50°C liegen.
Je geringer die Temperaturdifferenz zwischen der Vorlauftemperatur und der aus der Umwelt aufgenommenen Wärme ist, desto weniger Strom benötigt die Wärmepumpe. Eine Dämmung des Gebäudes ist daher nötig. Wer eine Wärmepumpe installieren lässt, sollte außerdem im Idealfall eine Fußboden-, Wand- oder Deckenheizung nutzen, da diese Heizflächen in der Regel mit niedrigeren Temperaturen unter 40 Grad Celsius auskommen.
„Wichtig für einen effizienten Betrieb ist zudem eine sorgfältige Fachplanung inklusive einer guten Einbindung in das Heizsystem“, sagt Jörg Knapp vom Fachverband Sanitär-Heizung- Klima Baden-Württemberg. „Unter anderem ist ein hydraulischer Abgleich der Heizung dringend erforderlich.“ Er sollte unbedingt nach dem Berechnungsverfahren B ermittelt werden. Mit dem Verfahren berechnen Experten präzise die Heizlast für jeden einzelnen Raum. Hauseigentümer erhalten so die exakte Leistungsanforderung an die Wärmepumpe. Es ermöglicht einen besonders effizienten und kostensparenden Betrieb.
Welche Wärmepumpen gibt es und wie funktionieren sie?
Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen: Bei Erdwärmepumpen beispielsweise wird eine Flüssigkeit durch im Erdreich verlegte Rohrleitungen gepumpt und dabei von der Temperatur des Bodens erwärmt. Grundwasserpumpen saugen Grundwasser an und entziehen ihm Wärme. Luftwärmepumpen nutzen Außenluft als Wärmequelle. „Alle Arten von Wärmepumpen haben gemeinsam, dass die aufgenommene Wärme anschließend mit Hilfe von Strom auf ein höheres, nutzbares Temperaturniveau für Heizung und Warmwasser gebracht wird“, erklärt Knapp. Manche Wärmepumpen können im Sommer übrigens auch kühlen. Ist das der Fall, entziehen sie den Innenräumen über die Heizflächen Wärme und geben sie an die Luft, das Grundwasser oder das Erdreich ab. Im letzten Fall wird gleichzeitig der Untergrund für den nächsten Winter vorgewärmt.
Welche Art von Wärmepumpe sich im Einzelfall am besten eignet, hängt von verschiedenen Faktoren ab. So sind Luftwärmepumpen zwar preiswerter, zum Teil aber geräuschintensiver und daher nicht immer für den Einsatz in dichtbesiedelten Gebieten geeignet. Zudem liefern sie weniger Wärme pro eingesetzter Kilowattstunde Strom. Erdwärmepumpen sind hingegen besonders energieeffizient und leise, aber gegenüber anderen Wärmepumpentypen aufgrund der notwendigen Erdarbeiten kostenintensiver. Grundwasserpumpen sind am wenigsten verbreitet, bieten aber vor allem für größere Projekte in der Nähe von Seen oder Flüssen eine interessante Alternative. Bedacht werden sollte: Wärme aus Erde oder Grundwasser kann aufgrund geologischer oder wasserrechtlicher Gegebenheiten nicht überall uneingeschränkt genutzt werden.
Informationen
zukunftaltbau.de